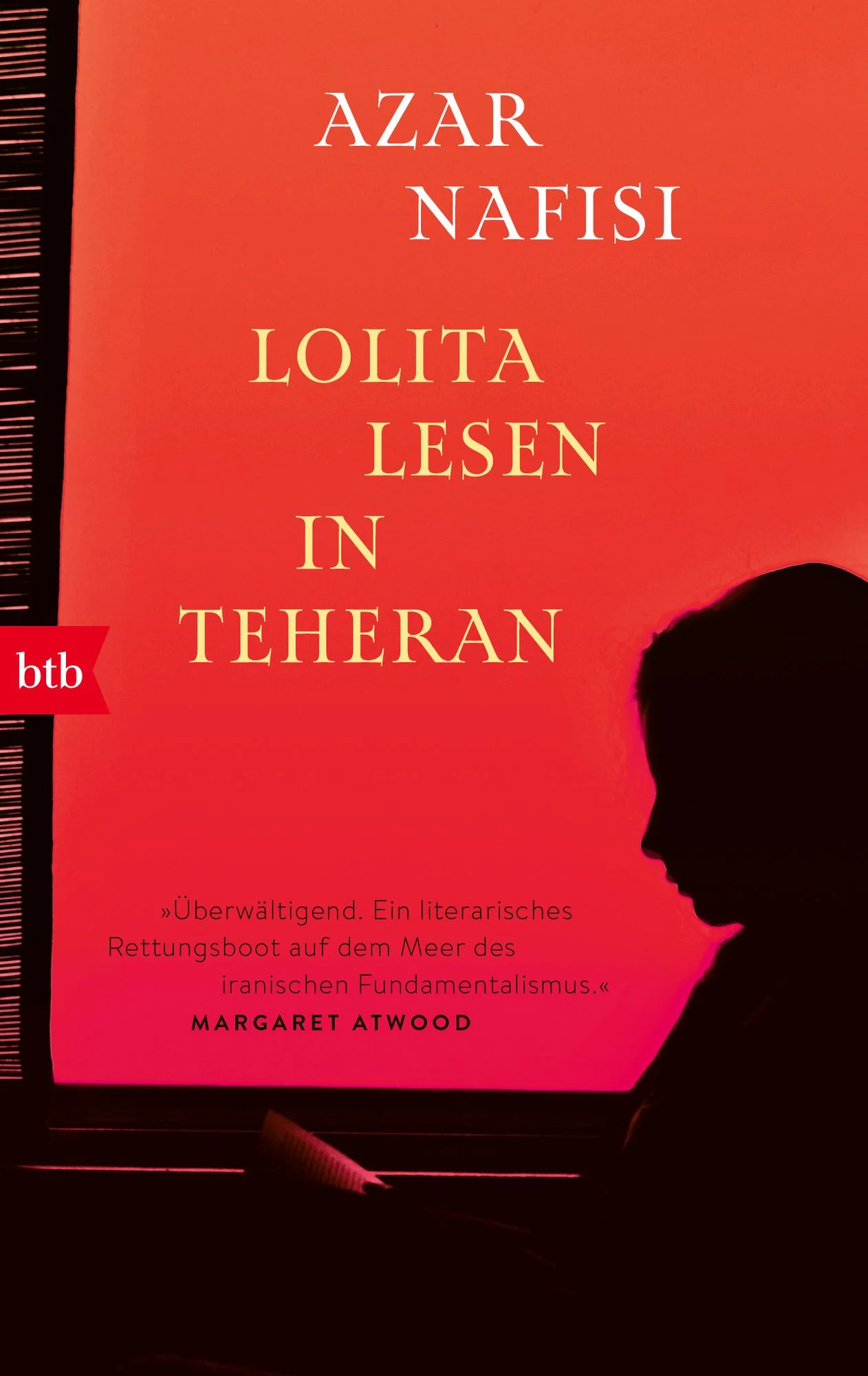 Das Buch zum Film, der derzeit in deutschen Kinos läuft
Das Buch zum Film, der derzeit in deutschen Kinos läuft
Claudia Schulmerich
Frankfurt am Main (Weltexpresso) – So etwas ist mir noch nie passiert. Da fange ich dieses Buch – also LOLITA LESEN IN TEHERAN – zu lesen an, richtig glücklich, nachdem ich mein Unverständnis, warum ich es beim Erscheinen, original in den USA, übersetzt in Deutschland 2003, nicht mitbekommen hatte, mißmutig mir vorgeworfen hatte und jetzt ja nur deshalb zum Lesen kam, weil am Donnerstag letzter Woche in Deutschland die Verfilmung angelaufen ist, ich fange also zu lesen an – und es gefällt mir überhaupt nicht! Dann auf Seite 133 – es handelt sich um eine Autobiographie, die junge iranische Literaturwissenschaftlerin, die mit 13 Jahren in die USA ging, wo sie mit 17 heiratet und ausgebildet wies – kommt 1979 mit dem zweiten Ehemann nach dem Sturz des Schahs durch den politischer und religiösen Führer der Islamischen Revolution von 1979 Khomeini, bis zu seinem Tod iranisches Staatsoberhaupt, in ihre Heimat zurück. Übrigens wird mit dieser Szene auch der Film beginnen. Und ab jetzt lese ich dies Buch Stunden um Stunden ganz langsam und intensiv und finde es wunderbar.
Warum mir der Anfang nicht gefiel, der doch eigentlich interessant ist? Später. Erst einmal eine grobe Einordnung dieser Biographie, die in einem Buch gleich mehrere vereint: es ist erst eine 13jährige Exilgeschichte, dann die Geschichte einer Heimkehr, die nach 17 Jahren Leben in Teheran aber 1997 wiederum ins amerikanische Exil führt, es ist aber auch eine Literaturgeschichte über den modernen zeitgenössischen amerikanischen Roman anhand von Nabokov, Fitzgerald, Bellow – wobei hier wieder besonders interessant wird, dass mit dem Russen Nabokov ja auch ein Exilant auf Amerikanisch schreibt, Lolita erschien 1955, und die Autorin, die so viel über Teheran und das dortige Leben schreibt, schreibt dies auf Amerikanisch! Ihre Literaturgeschiche, die wir durch ihre Seminare und Gesprächskreise inhaltlich mitbekommen, berührt aber auch intensiv Jane Austen, durchaus in der Abgrenzung zu den Brontë-Schwestern, und zu meinem persönlichen Vergnügen vertiefend auch Henry James, der wiederum als Exilant aus Amerika in England neue Heimat fand, auf Englisch schrieb, aber sehr oft Amerikaner, die nach Europa kommen, als literarisches Personal nutzt.
Wie angenehm, in einem Buch zu lesen, wo der Hinweis, dass der Ehemann von Azar Nafisi gerade DER LANGE ABSCHIED liest, ausreicht, um zu wissen, was er liest und wie die Stimmung ist, dass man also im Kopf Raymond Chandler hinzufügt oder einfach als Hintergrund weiß, ohne den Name formulieren zu müssen. Ja, was die Literatur angeht, ist LOLITA LESEN IN TEHERAN ein Buch für Eingeweihte, für Literaturliebhaber, für Literaturkenner. Das macht es mir sympathisch. Und denke ich denn gar nicht an die, die nicht wissen, wenn sie von DIE GESANDTEN, EINLADUNG ZUR ENTHAUPTUNG, DER REGENKÖNIG, DAS OPFER, STOLZ UND VORURTEIL, DAISY MILLER oder EMMA lesen und sich vielleicht überfordert oder gar dumm vorkommen, weil sie nicht wissen, von wem die Romane sind und um was es da geht? Nein, denke ich nicht, denn man kann ja nachschauen, von welchem Autor, welcher Autorin die jeweiligen einem nicht bekannten Titel sind. So ist das immer, dass man durch Lesen schlauer wird, durch aktives Lesen, denn das sind ja Anregungen, die wir hier erhalten, sich selbst der Literatur zu bemächtigen, die man noch nicht kennt. (S. 416) So sieht man den Iran, selbst den unter den Mullahs, die alles verbieten, geradezu mit Rührung, wenn Ehemann Bijan fragt: „Wo sonst in der Welt würde ein Vortrag über Madame Bovary solche Menschenmengen anziehen und fast zu einem Aufstand führen?“ Wir dürfen nicht aufgeben und gehen; wir werden hier gebraucht.“ Das Streben nach Kunst und Kultur eines großen Teils der Bevölkerung kommt voll zum Ausdruck.
Angenehm auch, dass der Ehemann, von Beruf Architekt, als feste Größe zwar vorhanden ist, aber im Hintergrund bleibt und wir nicht eine Ehe- oder Familiengeschichte erfahren, sondern das Leben einer intellektuellen, an Kunst und hier vor allem an westlichen oder russischen Filmen interessierten Gemeinschaft, denn auch die Freunde spielen eine Rolle, vor allem aber der kleine Kreis von sieben Frauen, die privat in der Wohnung der Autorin jeden Donnerstagmorgen zusammenkommen. Über Jahre.
Zuvor hat die Professorin, darum kam sie ja zurück, an der Hochschule eine Stelle als Professorin für Literatur besetzt, hatte aber von Anfang an das Gefühl, das sie nicht frei in ihren Entscheidungen isei, weder, was das Fachliche angeht, die Auswahl des Lehrstoffes und schon gar nicht als Frau frei, denn der Schah und damit die „westliche Unzucht“ ist kaum des Landes vertrieben, da tritt die islamische Zucht ein, Frauen müssen ihr Frausein verhüllen, das totale Kopftuch wird Pflicht. Unter solchen Bedingungen kann sie nicht arbeiten, verläßt teils ihrerseits, teils herausgeschmissen die Uni, nachdem sie sich geschworen hat, nie mit Kopftuch zu unterrichten. Aber irgendwann kehrt sie mit Kopftuch an die Uni zurück und man kann das gut verstehen, denn sie hat keine andere Wahl, will sie Ihre Liebe und Leidenschaft, ihre Kenntnisse zur Literatur weitergeben.
Spannend, was sie mit den Studentinnen, die gut dabei wegkommen, und Studenten, unter denen es islamistische Idioten, aber auch kluge Kerle gibt, inhaltlich bespricht und eine Nummer für sich wird der Prozeß gegen DER GROßE GATSBY. Wie, was? Ganz einfach, als die Islamisten unter den Studenten immer wieder diesen „unsittlichen“ Roman F. Scott Fitzgeralds aus dem Jahr 1925 anprangern, wo es den Seitensprung der Ehefrau und andere schreckliche Geschehnisse gibt, nimmt die Professorin dies zum Anlaß, in ihren Veranstaltungen einen Prozeß gegen das Buch zu simulieren. Das ist echt ein Heidenspaß, wenn die männlichen Wütenden jetzt die Regeln des Gerichts einhalten müssen, Begründungen finden müssen, denn da langt es nicht, zu sagen, das ist unsittlich, da muß man schon genau sagen, was Sache ist. Das aber bedeutet, die jungen Männer müssen das Buch lesen, was sie vorher nicht taten, denn es läßt sich leichter über fehlende Moral räsonieren, wenn man das Sujet nicht kennt.
Die Autorin, also die Professorin, übernimmt übrigens im Prozeß die Rolle des Buches. Natürlich ist das eine Episode, aber zeigt doch, wie man mit Köpfchen diese religiösen Sittenwächter überlisten kann. Doch davon kann die Autorin auf Dauer nicht leben und verläßt wieder die Universität. Das wäre eine in sich geschlossene Geschichte, aber dieser Roman leistet sehr viel mehr. Es kommt eine weitere Ebene hinzu, das Leben, das ‚normale‘ Leben in Teheran zu Zeiten der Revolution (1979-81) und dann – ganz wichtig! – unter den Bedingungen des Krieges gegen den Irak (1980-1988), den wir den ersten Golfkrieg nennen. Abgesehen davon, dass von heute aus dieser Krieg noch unsinniger ist, als er eh war, kennen wir die Auswirkungen auf die iranische Bevölkerung wenig. Es ist ein richtiger Krieg, so wie wir derzeit die Bomben auf die Ukraine, die Zerstörungen der Häuser und die vielen Toten mitbekommen, genauso gab es die unmenschlichen Verhältnisse im Iran, die acht Jahre andauerten und eine äußerliche Einheit mit der politischen Führung brachten. Immerhin hat die Autorin auch danach noch neun Jahre auf eine Verbesserung der politischen Verhältnisse gehofft, bis sie zu der Tat schritt, die sie eigentlich nicht wollte: erneut das Land zu verlassen, in die USA zu gehen, wo sie, wie sie wußte, aufgrund ihrer Ausbildung und des universitären Wirkens jederzeit eine Professur für Literatur an einer amerikanischen Universität bekäme. So war es auch. Sie ging an die Johns-Hopkins-Universität in Washington und blieb.
Bleibt, über den Anfang und damit auch über die Zusammentreffen der sieben jungen Frauen zu den Donnerstagvormittagen im Haus der Professorin zu sprechen. Wer die streng islamische Welt kennt, der weiß, dass sich unter den tristen schwarzen Umhängen und totalen Kopfbedeckungen junger Frauen sehr bunte und durchaus ausgeschnittene Kleidung verbirgt, in diesem Fall T-Shirts mit Jeans, also keine traditionelle iranische Kleidung und lange, offene Haare. Und wer diese Länder kennt, der weiß auch, dass zum Zusammensein auf jeden Fall ein Tisch voller Leckereien gehört, die wechselweise mitgebracht werden. Und Tee. Die Gespräche über Literatur sind interessant, aber man interessiert sich fast mehr für die persönlichen Schicksale der jungen Frauen. Was mißfiel also am Anfang? Mir? Der Ton und die Rolle, die die Autorin sich selber gibt. Daß sie keine politische Aktivistin ist, versteht man schnell, das muß sie ja auch nicht sein. Aber sie verfällt immer wieder in eine Gemengelage, wo Kleinigkeiten eine Dimension annehmen, während für die Leserin die Folgerungen eigentlich auf der Hand liegen. Dieses Problem verliert sich aber, wenn sie – siehe oben – mit ihrer Rückkehr aus den USA eher zeitlich kontinuierlich erzählt. Man vergißt den Anfang dann sowieso, weil einen die Lektüre packt. Neben den politischen und gesellschaftlichen Hintergründen der iranischen Revolution und den folgenden Repressionen, neben den literarischen Kostbarkeiten ist es auch die sprachliche Verarbeitung des Geschehens. Das ist – vom spannenden Inhalt also ganz abgesehen – ein poetisch angehauchtes Buch, das man auch wegen des angenehmen Sprachduktus einfach gerne liest. Wie gut, dass es den Film gibt, sonst hätte ich dies Buch verpaßt.
Foto:
Umschlagabbildung
Info:
Azar Nafisi, Lolita lesen in Teheran, btb, 2023
ISBN 978 3 442 77380 0