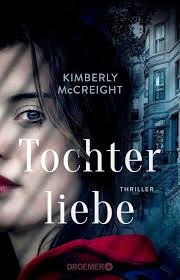 Ein Erzählmuster in US-amerikanischen Thrillern, Teil 1/2
Ein Erzählmuster in US-amerikanischen Thrillern, Teil 1/2
Claudia Schulmerich
Frankfurt am Main (Weltexpresso) – Wahrscheinlich hätte ich nicht darauf geachtet, wenn ich die beiden Krimis nicht dicht hintereinander gelesen hätte. Wobei ich KILLERPOTENTIAL von Hannah Deitch zuerst las, aber erst bei TOCHTERLIEBE erkannte, wie heutzutage in den zu Thrillern erklärten Krimis der Erzähler, die Erzähler die Leserin derart verwirren, dass sie schon deshalb den Schauer des Mysteriösen verspüren. Es geht um die Unzuverlässigkeit, auch die Vielzahl der Erzähler.
Wir kennen alle den durchgehend zu uns sprechenden auktorialen Erzähler, der fernab des Geschehens, also unbeteiligt, uns auch noch die innersten Regungen der handelnden Personen nahebringt, einfach, weil er alles weiß, Herr der Handlung ist, weil bei ihm alles zusammenläuft. Wir kennen in Abgrenzung dazu den persönlichen Erzähler, der in der Ichform von den eigenen Gefühlen, den Überlegungen und der Sicht der Handlung erzählt. Traditionell wird das in Krimis oft so gehandhabt, dass in den Kapitelüberschriften der Name desjenigen erscheint, um den es gerade geht: entweder in der Ichform oder eben, dass diejenige Person gerade im Fokus steht, von ihr erzählt wird.
Doch diese neue Art des Erzählens unterläuft so klare Einordnungen und Abgrenzungen. Bevor wir dies weiterverfolgen, erst einmal die schaurige Geschichte, die aber über die Erzählform hinaus ebenfalls Ähnlichkeiten mit dem Pendant: KILLERPOTENTIAL hat. Es geht immer um Familien, ein enger Kreis, von dem erzählt wird, in deren Umfeld sich die Krimihandlung bewegt und kaum weitere, gesellschaftliche Hintergründe auftauchen. Übrigens bringt diese Konstatierung einen Unterschied zu den Krimis zutage, die es auf die Krimibestenliste schaffen und eigentlich immer das gesellschaftliche Umfeld des personalen Geschehens mitreflektieren. Gewissermaßen den weiteren Blick haben und nicht derart auf Einzelpsychologisches aus sind wie diese Thriller, die wie gesagt, gerne im Familienkreis spielen. Schon Karl Krauss hatte gesagt: „Das Wort »Familienbande« hat einen Beigeschmack von Wahrheit.“ Das beweisen die meisten heutigen Thriller, die sich das Innere von Familienleben zum Inhalt nehmen.
In dieser Familie dreht sich alles um die „Helikopter-Mutter“ Kat, was für Katerina steht. Sie verdient das reichliche Geld für die Familie als Spitzenanwältin in einer Kanzlei, wo sie für die Spezialfälle zuständig ist. Offiziell gilt sie als Patentanwältin, aber ihre eigentliche Arbeit besteht im Beseitigen von Problemen, sie ist eine effiziente Löserin jeglicher Probleme, wobei ihre Methoden durchgreifend, auch psychologischer, aber nicht krimineller Natur, sondern nur effizient sind. Von all dem ahnt ihre Tochter Cleo nichts. Die ist überhaupt ahnungslos und für die Leserin ob ihrer Zuneigung zu einem Vater, der insgeheim die Mutter betrügt und das in jeglicher Hinsicht: durch Geliebte, durch Geld, durch Verschweigen immer wieder ein Stein des Anstoßes. Das kennt man aus dem realen Leben, dass Töchter den Müttern deren wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg neiden und die davon profitierenden Väter emotional mit Wärme begegnen, die Mütter aber durch Entzug der eigenen Person strafen.
Insofern finden wir hier eine ganz typische Familienkonstellation vor, die aus dem Ruder läuft, weil Cleo, die in einem Studentenheim wohnt, sich dazu herabgelassen hat, die Mutter auf deren Wunsch hin zu Hause zu besuchen, beim Kommen aber nur deren blutigen Schuh und ein kaputtes Glas auf dem Boden vorfindet. Der Thriller handelt ab jetzt davon, was hier geschah und vor allem, ob die Mutter noch lebt und ermordet wurde, denn die folgenden Tage bleibt sie verschwunden.
Es beginnt mit Cleo, die als Icherzählerin die Familienkonstellation beschreibt, auf dem Wege nach Hause ist, dort ankommt, die Verwüstung sieht und die Mutter vermißt. Zwischengeschaltet sind der eigentlichen Handlung gegenüber juristische Sachverhalte einer Pharmagesellschaft, sowohl Aktennotizen wie Einlassungen vor Gericht, die in einem anderen Schriftbild sofort abstechen und den Hintergrund für eine der Einsätze der Anwältin und Mutter sind. Und dann beginnt das Verwirrspiel, in dem Katrina, die Mutter, ebenfalls als Icherzählerin loslegt, allerdings acht Tage zuvor. Es folgt „Cleo, Dreißig Minuten danach“, „Katrina, Sechs Tage zuvor“, „Cleo, Drei Stunden danach.“ Den, den Personen zugeschriebenen Kapiteln, die immer in der Ichform erzählt werden, sind weitere Protokolle zwischengeschaltet, die aber jetzt von den Sitzungen von Cleo mit ihrer Therapeutin handeln, also deren Reden während der Sitzung notieren.
Als Leserin ist man also ständig mit Überlegen beschäftigt, wer gerade spricht und was sich dadurch an der Gesamteinschätzung ändert. Das ist absolut professionell gemacht und die Autorin hält das Versteckspiel mit dem Eigentlichen gekonnt durch. Es stellt sich beim Lesen eine Sympathie zur verschwundenen Mutter her, die eine mehr als schwierige Kindheit und Jugend in einem Waisenhaus hatte und die zu den Frauen gehört, die ständig die Probleme von anderen lösen, beruflich sowieso, aber auch privat.
Für diesen Krimi gilt zudem, dass er nicht auf das Private der Familie beschränkt bleibt, was zwar Hauptthema bleibt, aber durch besagte Pharmafirma eben doch auch das Wirtschaftsleben tangiert. Man merkt aber deutlich, dass die ramponierte Tochter-Mutter-Beziehung sowie die stets innerlich vorhandene Mutter-Tochter-Beziehung und die lausigen Ehemänner das intensiv dargestellte Thema bleiben, während der Pharmakonflikt eher lieblos abgehandelt wird. Mehr darf man nicht verraten.
Das Erzählmuster besteht aus den beiden Icherzählerinnen Katrina, Mutter und Cloe, Tochter, die jeweils mit Zeitangaben in die Vergangenheit versehen sind, zu denen Protokolle, Abschriften, sachliche Schreiben hinzukommen. Es ist ein ständiges Hin und Her, weil nicht nur die Personen wechseln, sondern vor allem die Zeiten, die weit in die Vergangenheit zurückreichen.
Foto:
Umschlagabbildung
Info:
Kimberly McCreight, Tochterliebe, Thriller, Droemer Verlag 2025
ISBN d978 3 426 44946 2


